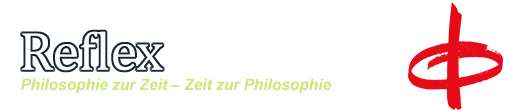Stamer in philosophie.de
Gerade ist ein Abiturient zu mir gekommen, der einen nicht ganz unbekannten Philosophen besucht hatte, um sich von ihm für ein Studium der Philosophie beraten zu lassen. Der nicht unbekannte Philosoph hatte ihm entschieden abgeraten. Das Philoso- phiestudium böte überhaupt keine Berufsperspektive mehr. Immer mehr Stellen an den Universitäten würden gestrichen. Und er wolle ja wohl nicht als Taxifahrer enden. Hoffnung könne er ihm jedenfalls machen. Der Abiturient hätte nun verwirrt sein müssen nach einer solch niederschmetternden Aussicht, die ihm ein Mann vom Fach servierte. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, amüsierte er sich über die höchst resignative Einstellung des Professors an einer der berühmtesten Universitäten des Landes. Und ganz im Gegenteil ist auch seine Absicht , Philosophie zu studieren, durch die Schwarzmalerei des Professors nicht in geringsten in Zweifel geraten. Ja klar, könnte man sagen, die Jugend hat eben noch nicht den Blick für die Realität. Und man könnte auch darauf hinweisen, dass einst Schiller den jungen Novalis nicht zur Lyrik geraten hat, sondern ihm dringend anempfahl, eine vernünftige Berufswahl zu treffen. Wer kennt ihn nicht, den väterlichen Spruch, doch nicht eine der brotlosen Künste zum Beruf machen zu wollen. Und es trifft zu, dass Stellen gestrichen werden. Und es trifft zu, dass ein hoher Prozentsatz der Absolventen des Philosophiestudiums in einem Job landen, zu dem sie kein Studium brauchten – abgesehen von dem ebenfalls hohen Pro- zentsatz der Studienabbrecher. Kann es also ein vernünftiger Vertreter der Philosophie einem Abiturienten raten, Philosophie zu studieren?
Was ist Realität? Worin besteht ein Realitätssinn? Es ist die Frage, wie weit sich der ältere Ratgeber mit seinem Realismus, den er sich zu Gute hält, selbst durchschaut. Zunächst setzt ja der Professor, der sicherlich über die Streichungen von Stellen an der Universität empört ist, und der sicherlich auch deprimiert ist, weil er seinen Studen- ten keine großartigen und sicheren Perspektiven zu einer Berufsausübung als Philosoph geben kann, mit seiner negativen Einstellung die Tendenz zur Stellenstreichung und überhaupt zur Verringerung des quantitativen Anteils der Geisteswissenschaft an den Studienfächern fort. Er fängt mit seiner Haltung gewissermaßen die Studenten schon vor Beginn des Studiums ab. Er löst das Problem der Bürokratie mit arbeitslosen Studien- abgängern, das später entsteht, schon am Anfang – selbstverständlich außerordentlich wohlmeinend. Sicherlich versteht er sich ernsthaft als ehrlicher Berater der Jugendlichen. Aber dass er zugleich der Agent der Bürokratie, bzw. einer Gesellschaft ist, die junge Menschen in die Arbeitslosigkeit schickt, das ist ihm wohl entgangen. Entgangen ist ihm auch wohl, dass der Realismus eines älteren Menschen ein anderer ist als der eines jungen Menschen. Der ältere trägt keine Berge mehr ab, der junge mag daran scheitern, es zu wollen, aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem er scheitert, ist nicht gewiß, ob er scheitert.
Jugend setzt etwas in Bewegung. Es steht nicht fest, ob die Eingliederung einer stets wachsenden Zahl qualifizierter junger Menschen in die Schubläden der sozial abgesicher- ten Arbeitslosenstatistik wirklich gelingt. Die Gesellschaft ist im Fluß. Er kann so gar nicht mehr weitergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange es so noch weiter- geht. Dies zu wissen, wäre einem Philosophen würdig. Sich darauf vorzubereiten, das wäre eine Sicht der Dinge, die einem Philosophen entspräche. Diesen Wandel nicht nur vorauszusehen und sich darauf einzustellen, sondern mit Ideen ihn zu beschleunigen, ihn zum Durchbruch zu verhelfen, das wäre die Konsequenz für einen Philosophen – zumal für einen jungen; für einen älteren aber, ihn auf diese anstehende gesellschaft- liche Auseinandersetzung vorzubereiten. So aufgefaßt würde die Philosophie lebendige aktuelle Philosophie sein, als deprimierter hingegen die Studenten zu verscheuchen, ist der Verlust des philosophischen Elans. Da bekommt der alte Vorwurf gegen die Philoso- phie, dass sie doch im Kern unpraktisch sei, neue Nahrung In ihrer resignativen Form ist sie unpraktisch. Die Gesellschaft braucht dringend Philosophie in dieser Zeit, in der alles der Ökonomie zu verfallen scheint, in der ungeahnte Probleme bestehen, die nicht einmal angefasst sind – von den geahnten und gewussten ganz zu schweigen. Die Ge- sellschaft braucht Philosophen, deshalb ist es unverantwortlich, wenn Philosophen vom Philosophiestudium abraten.